Die sanfte Kunst der Beeinflussung – und ihre politische Sprengkraft
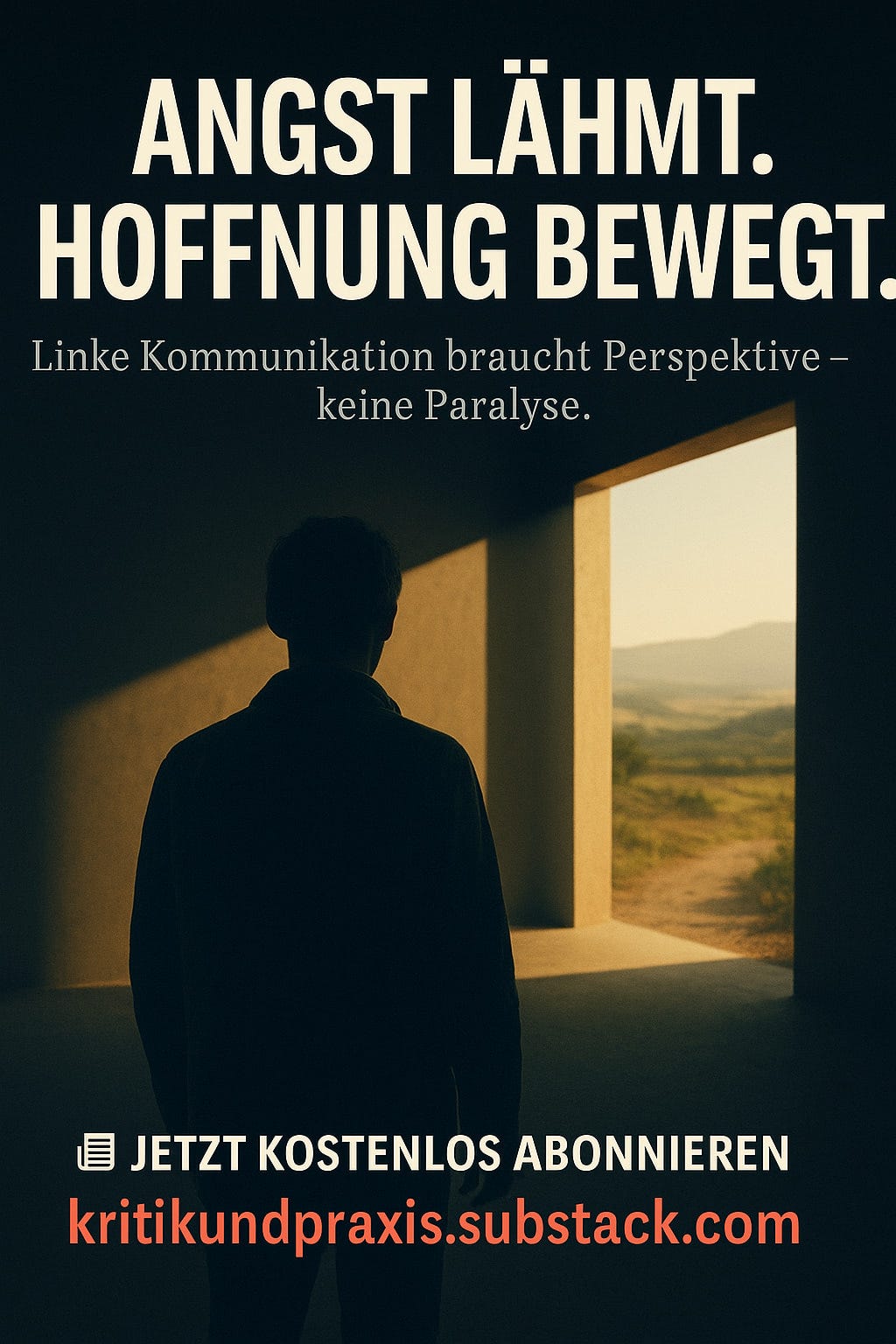
Warum Emotionen mehr verändern als Argumente – und was linke Bewegungen daraus lernen müssen
Von außen betrachtet, scheint die Gegenwart von einem Mangel an Vernunft geprägt: Fakten werden geleugnet, Wissenschaft ignoriert, politische Debatten in Meme und Moralfuror zersetzt. Doch wer in dieser Kakophonie nur ein Informationsdefizit wittert, unterschätzt die eigentliche Dynamik – nämlich die Macht der Emotion, der Hoffnung, der sozialen Zugehörigkeit. Es ist kein Zufall, dass Populisten, Start-up-Gurus und Lifestyle-Coaches mehr Menschen mobilisieren als Gewerkschaftsflyer oder Fußnoten-Marxisten.
Die Neurowissenschaftlerin Tali Sharot legt mit The Influential Mind ein ebenso elegantes wie verstörendes Buch vor, das die neuronalen Mechanismen der Überzeugung seziert – und dabei eine Erkenntnis ins Zentrum rückt, die linke Bewegungen lange unterschätzt haben: Menschen lassen sich nicht durch Evidenz verändern, sondern durch Erregung.
Die große Lücke zwischen Erkenntnis und Handlung
Sharots zentrale These ist bestechend einfach: Unser Gehirn liebt Klarheit, Bestätigung und Optimismus. Wer diesen Sehnsüchten entgegenkommt, dringt leichter durch. Wer hingegen mit Widerspruch, Komplexität oder Angst argumentiert, erzeugt Abwehr. Rationalität, so paradox es klingt, hat geringe Überzeugungskraft. „Emotions drive decisions“, schreibt Sharot – und formuliert damit einen Imperativ, den Werbeagenturen längst verinnerlicht haben, während linke Diskurse oft noch in Aufklärungsrhetorik verharren.
Doch wie umgehen mit dieser Einsicht? Soll linke Politik sich nun selbst dem Marketing opfern? Authentizität simulieren, Angst durch Hoffnung ersetzen, Narrative basteln wie Silicon-Valley-Coaches?
Nicht unbedingt. Aber es braucht eine strategische Wendung: Aufklärung ohne Affekt bleibt stumm. Emanzipation ohne Emotion bleibt leer.
Vom richtigen Gebrauch der Gefühle
Die bürgerliche Öffentlichkeit hat einen Hang zur Gefühlsverachtung – Emotionen gelten als unpolitisch, privat oder gar gefährlich. Linke Theoretiker:innen, von Adorno bis Bourdieu, pflegten ebenfalls ein ambivalentes Verhältnis zu Gefühlen. Ihre Stärke war die Analyse der Verhältnisse – nicht die Erzählung des Begehrens.
Dabei zeigen psychologische Studien: Menschen verändern sich dann, wenn sie sich gesehen, verbunden, hoffnungsvoll fühlen. Was populistische Rechte per Identitätsangebot leisten, müssten progressive Bewegungen auf Basis von Solidarität und Würde anbieten. Nicht Gefühle ansprechen, um zu manipulieren – sondern Gefühle ernst nehmen, um zu politisieren.
Die Zukunftsfrage lautet also: Wie schaffen wir Räume, in denen Wut nicht isoliert, sondern kollektiv wird? Wo Hoffnung nicht vertröstet, sondern mobilisiert? Wo Erzählung nicht verkitscht, sondern entlarvt?
Klassenkampf im limbischen System?
Sharots Thesen berühren eine heikle Grenze: Sie deuten an, dass wir Menschen nicht durch Wahrheit überzeugen, sondern durch Anschluss. Das stellt auch die klassische linke Hoffnung auf Vernunftgemeinschaften infrage. Die Arbeiterklasse, das Subjekt der Geschichte, war nie nur eine ökonomische Kategorie – sondern auch ein Ensemble von Gefühlen: Stolz, Ohnmacht, Zorn, Gemeinschaft.
Wenn heute rechte Influencer Millionen erreichen, liegt das nicht an ihren Argumenten, sondern an ihrer emotionalen Architektur. Sie liefern ein Gefühl von Bedeutung, Ordnung, Zugehörigkeit. Linke Politik hingegen wirkt oft belehrend oder moralistisch – nicht, weil sie falsch liegt, sondern weil sie emotional defizitär bleibt.
Deshalb ist die Frage nicht: Wie emotionalisieren wir die Politik? Sondern: Wie politisieren wir die Emotion?
Hoffnung als radikale Praxis
Eine der provokantesten Einsichten des Buchs lautet: Angst funktioniert schlechter als Hoffnung. Auch das widerspricht linken Traditionen, die sich gern in Krisenprognosen üben – vom ökologischen Kollaps bis zur kapitalistischen Totalität. Doch Apokalypse paralysiert. Wer nur zeigt, wie schlimm alles ist, liefert bestenfalls eine intellektuelle Depression. Was fehlt, ist die Perspektive: Was kann ich tun? Wo kann ich wirken? Wofür lohnt sich Kampf noch?
Sharots Antwort: Gib den Menschen konkrete Schritte. Gib ihnen Anschluss. Gib ihnen eine Geschichte, die sie nicht nur verstehen – sondern fühlen können. Wer das als Manipulation abtut, hat nicht verstanden, wie tief das Politische im Menschlichen wurzelt.
Fazit: Mehr als ein Gehirnbuch
Tali Sharots „The Influential Mind“ ist kein agitatorisches Manifest. Es ist ein analytisches Besteck – und zugleich ein Spiegel. Wer es ernst nimmt, erkennt: Die neoliberale Hegemonie hat nicht nur Märkte geschaffen, sondern auch Affektlandschaften. Wer sie verschieben will, muss nicht nur Marx lesen – sondern lernen, zu erzählen. Zu berühren. Zu hoffen.
Die Parole für eine neue politische Kommunikation könnte lauten:
Kein Klassenbewusstsein ohne Gefühl. Keine Wahrheit ohne Verbindung. Keine Revolution ohne Hoffnung.
Kritik & Praxis – Analysen, Klartext, Gegenmacht
Jetzt kostenlos abonnieren:
2x pro Woche. Klar. Kritisch. Verständlich.
